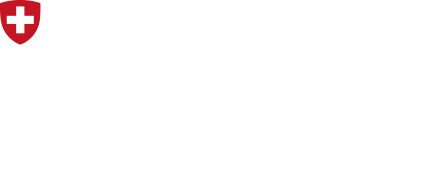Die rund 12,000 Menschen konnten nur das Nötigste retten und standen innerhalb weniger Stunden auf der Strasse – ohne ein Dach über dem Kopf, ohne Wasser, ohne Essen und ohne das bisschen Zuhause, das sie sich in den letzten Jahren oder Monaten aufgebaut hatten. „Ich schlief tief und fest, als das Feuer ausbrach,“ erzählt Ehmad aus Sudan. „Als ich aufwachte, war ich bereits von Flammen umzingelt. Ich hatte grosse Angst, denn es erinnerte mich an das Feuer, in dem ich meine Frau und meine zwei Kinder verlor.“
Ehmad war vor einem Jahr nach Lesbos gekommen und war einer der Ersten, die nach dem Feuer in Moria das neue Lager bezogen. Das Lager, das später den Namen New Lesbos Registration and Identification Centre erhielt, befand sich noch mitten im Aufbau. Die griechische Armee hatte es auf einem alten Militärübungsplatz am Meer in kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Viele Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten sträubten sich zu diesem Zeitpunkt noch, in die dort aufgestellten Zelte zu ziehen, da sie Angst vor einem „zweiten Moria“ hatten - eine Entscheidung, die Ehmad nicht verstand. „Die Situation auf der Strasse ist nicht gut. Ich fühle mich hier sicherer und habe zumindest ein Zelt, in dem ich schlafen kann,“ sagt der 37-Jährige und setzt seine Kopfhörer wieder auf. „Die konnte ich glücklicherweise retten,“ sagt er mit einem Lächeln. „Ich höre mir englische Geschichten an, denn so kann ich mein Englisch verbessern und die Misere hier für kurze Zeit vergessen.“ Zeba aus Afghanistan findet im neuen Lager wenig Trost. „Mir geht es gar nicht gut,“ sagt sie. „Ich habe vor zwei Monaten mein Baby verloren, und die Blutungen wollen einfach nicht aufhören,“ so die 32-Jährige, die ihre ständige Angst in Moria für ihre Fehlgeburt verantwortlich macht. „Nachts lag ich oft wach, denn im Lager hatten sich Gruppen von Männern gebildet, die in der Dunkelheit mit Messern unterwegs waren. Ich hatte schreckliche Angst, und das hat mir mein Baby genommen.“ Zeba und ihr Mann, die vor einem Jahr auf Lesbos angekommen sind, konnten kaum etwas aus dem Feuer retten. „Alles ist verbrannt – alles! Alle meine Kleider sind weg, und ich besitze nur noch eine Unterhose, was bei meinem derzeitigen Zustand ein grosses Problem ist.“
Ein paar Tage nach dem Brand in Moria trafen bereits die vier Tonnen Hilfsgüter der Humanitären Hilfe der Schweiz, der einzigen Regierungsorganisation vor Ort, auf Lesbos ein. Sie wurden mit einem eigens gecharterten Flugzeug auf die Insel gebracht, von der griechischen Armee entladen und ins Lager transportiert. „Morgen Abend wird im Lager sauberes Trinkwasser fliessen,“ so Patrick Kilchenmann, einer der vier WASH-Fachleute, die im neuen Lager ein Trinkwasserversorgungssystem aufbauen sollte. Eine grosse Herausforderung für das Schweizer Team, denn zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, woher das Wasser für die gelieferten Wasserreservoirs kommen sollte. Unsere Expertinnen und Experten telefonierten, suchten und fanden schliesslich einen Lieferanten, der am nächsten Tag die benötigten 30,000 Liter Trinkwasser ins Lager bringen sollte. Und tatsächlich: um 17 Uhr am 16. September floss sauberes Trinkwasser aus den Wasserhähnen, und Hunderte von Menschen kamen mit ihren Kanistern, PET-Flaschen, Eimern oder auch Schubkarren, um ihre Familien mit dem so dringend benötigten Trinkwasser zu versorgen. Ein besonderer Moment für die Lagerbevölkerung,die das Wasser so sehr brauchten. „Denn Wasser ist Leben,“ sagt Narges aus Afghanistan.
Es sprach sich schnell herum, dass es im Sektor Blue-C-des Lagers Trinkwasser gebe, was zu einer langen Warteschlange und dem zu erwartenden Chaos führte. Schon bald brauchte es ein paar Leute aus dem Schweizer Team sowie einige Freiwillige aus der Lagerbevölkerung, um die Menschenmenge an den Wasserhähnen und die geordnete Vergabe zu kontrollieren. „An den Wasserstellen kann man das Spannungspotenzial spüren,“ sagt Jean-Luc Bernasconi, Leiter des Schweizer Soforteinsatzteams in Moria.
Der Soforthilfeeinsatz auf Lesbos dauerte 20 Tage, und auch wenn es so manche kritische Stimme gab, welche die Humanitäre Hilfe der Schweiz für den Aufbau eines „zweiten Moria“ mit menschenunwürdigen Bedingungen verantwortlich machte, gab es aus humanitärer Sicht keine Alternative. Hätte man wegsehen und nicht helfen sollen? Die Menschen mussten bereits seit Tagen ohne genügend Trinkwasser auskommen, und hier war absolut Nothilfe gefragt. 34 Grad im Schatten ohne genügend Wasser – man möchte sich das gar nicht vorstellen.
Nun geht es darum, den Menschen auch weiterhin Hilfe zukommen zu lassen. Dazu gehört zum Beispiel die Unterstützung des lokalen Krankenhauses Vostanio in der Hauptstadt Mytilene, das die Humanitäre Hilfe der Schweiz mit COVID-Schutzmaterial und weiteren benötigten Gütern wie Beatmungsgeräten beliefert. Das lokale Spital ist völlig überlastet. Die Insel Lesbos mit ihren rund 86'000 Einwohnerinnen und Einwohnern beherbergt zurzeit rund 12'000 Flüchtlinge, was einem Drittel der Einwohnerzahl des Hauptorts Mytilene entspricht. Auch die Wasserversorgung und sanitären Einrichtungen müssen weiter verbessert werden. Hier arbeitet die Schweiz eng mit den griechischen Behörden zusammen.
Humanitäre Hilfe kann keine politischen Probleme lösen und ist nur begrenzt möglich. Es geht darum, Leben zu retten und Leiden zu lindern. Das steht bei der humanitären Hilfe an erster Stelle. Die Menschen brauchen aber auch eine Perspektive, denn hinter jeder Zahl, die man in den Medien hört oder liest, stecken menschliche Schicksale
Text: Billi Bierling, Mitglied des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe, Oktober 2020